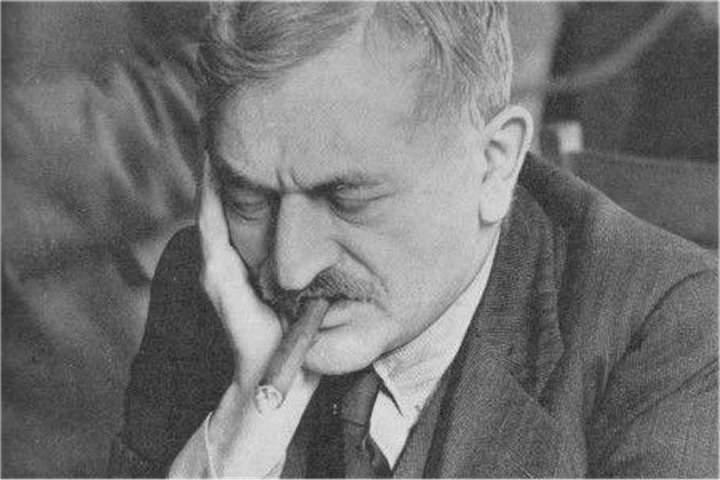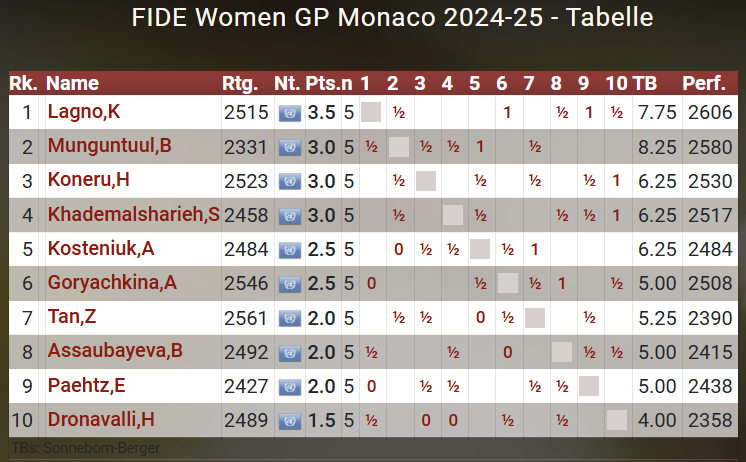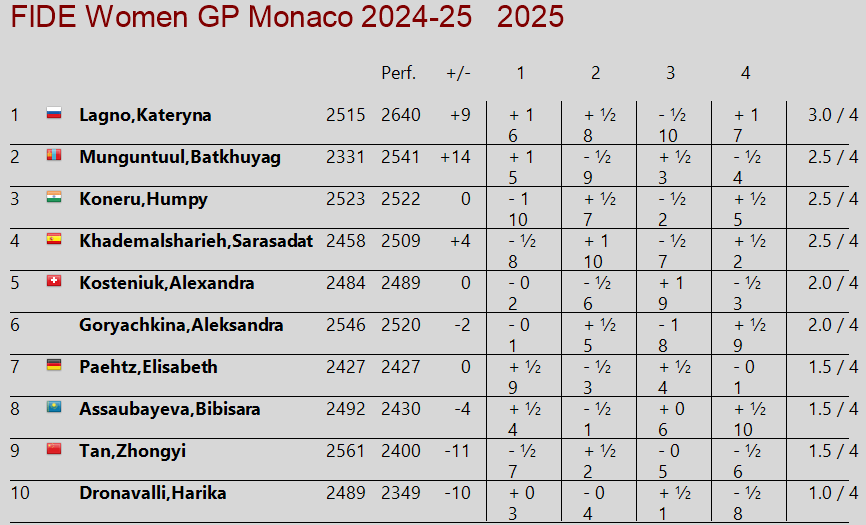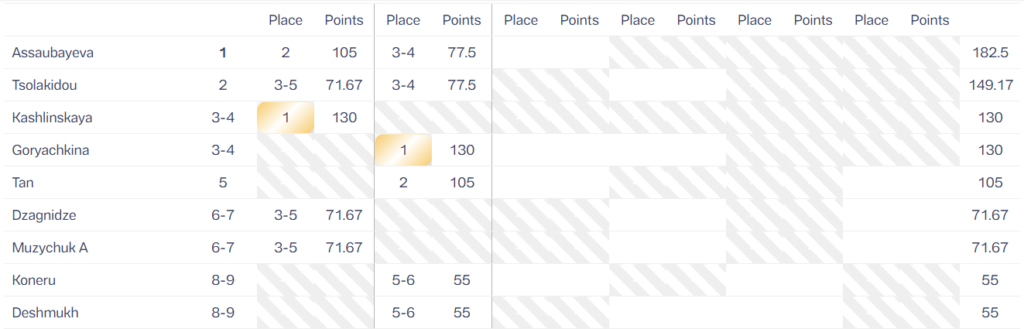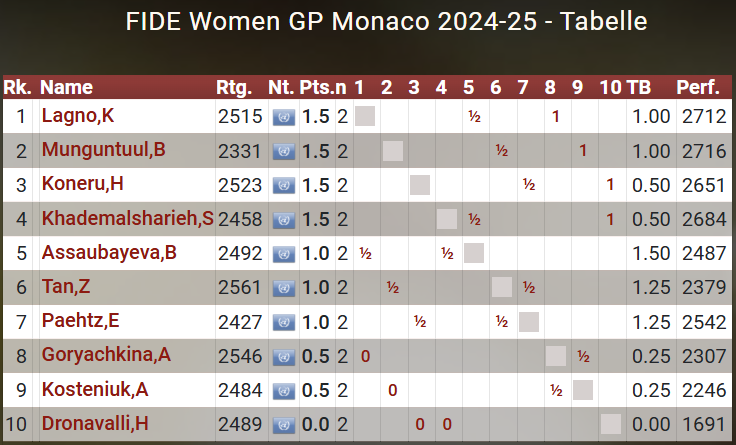Engländer in Prag. Fünf Momente.
Foto: Peter Kranzl
Bei den Senioren-Mannschaftsweltmeisterschaften in Prag sind viele Legenden am Start, Ex-Weltmeister und manche bärenstarke weniger bekannte Topspieler. Da gehen spannende und interessante Partien unter. Einige Beispiele mit englischer Beteiligung.
Von Thorsten Cmiel
Wir betrachten einige entscheidende Momente aus Partien in Prag. Wie es ausging und was richtig im Zweifel die jeweils richtige Entscheidung war, kann in einem späteren Beitrag auf dieser Website nachgelesen werden.
Wie sollte Schwarz auf die Mattdrohung am besten reagieren? Diese Stellung stammt aus der Partie des Internationalen Meisters Peter G. Large, der für England bei den älteren Senioren am Start ist. Diese Partie entschied den Spitzenkampf von England und Israel in der sechsten Runde. Large ist bis hierhin einer der Topscorer der Engländer mit 5.5 aus 6.
Schwarz hat zuletzt seine Dame von f7 nach e7 gezogen. Die Frage ist jetzt, ob Weiß die Damen tauschen sollte, schließlich gewinnt er anschließend den Bauern b7 mit Schachgebot. In der Partie der beiden Großmeister Peter Wells und Zoltan Varga entschied sich der englische GM falsch. Aber was war richtig?
In dieser Stellung war Weiß am Zuge. Auch diese Partie stammt aus der dritten Runde bei den Jungsenioren und dem Wettkampf zwischen Ungarn und England. Mit Weiß spielte der ungarische Internationale Meister Laszlo Krizsany (1971) und die schwarzen Steine führt der englische Großmeister Mark Hebden (1958). Hebden könnte auch bei den älteren Senioren mitspielen.
Diese Stellung stammt aus einer Partie von Großmeister Jacob Aagaard (1973), der für die Dänen bei den jüngeren Senioren spielt. Aagaard (Foto) ist einer der erfolgreichsten Schachbuchautoren und seit einigen Monaten Großverleger. Er findet trotzdem Zeit sich bei einem Seniorenturnier mit anderen Spielern zu messen. Michael Adams (1971) ist natürlich eine andere Klasse und so kam es wie es kommen musste. Aber es war knapp, da auch Adams zuvor nicht optimal gespielt hatte. Wie sollte Weiß hier noch Widerstand leisten?

Die dritte Partie aus dem Wettkampf der Engländer gegen die Ungarn aus der dritten Runde. Mit Weiß spielt hier Großmeister Atilla Czebe (1975) gegen Stuart Conquest (1967), der lange das inzwischen nicht mehr stattfindende Januar-Turnier in Gibraltar organisiert hat. Hier ist der Engländer am Zuge und spielte wie weiter?
Foto: Peter Kranzl Bei den Senioren-Mannschaftsweltmeisterschaften in Prag